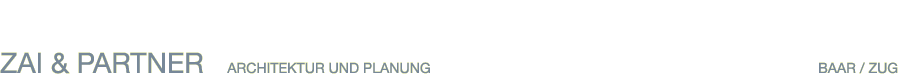Umbaukonzept
Eine unförmige Parzellengeometrie gibt der Villa eine neue Chance
Eine bekannte Konstellation: Die Familie entwächst dem Haus aus dem Jahre 1918, die langjährige letzte Bewohnerin stirbt, ein Erbgang steht an. Das Haus steht auf der Parzelle von 1'500 m2, in Zug ein rarer Artikel. Dank der Geometrie des Grundstückes welche eine marktgerechte Aufteilung erschwert, bekommt die gesunde Bausubstanz, eine neue Chance.
Die Liebe, die Wünsche und die Ansprüche
Eine Familie mit mehreren Kindern findet ihr Traumhaus: Ein Haus mit der liebevollen, geschwungenen Dachlandschaft, dem verwunschenen Garten und der herrlichen Lage in der Kleinstadt.
Doch wie es bei der Erfüllung der Liebe so geht, es braucht Geduld, immer wieder neue Anläufe, Entscheide werden verlangt, man lernt verzichten und erfährt erst später was man gewonnen hat. Die Zeit darf keine dominierende Rolle spielen.
Die verschiedenen, sich oft widersprechenden Ansprüche setzen einen intensiven, gründlichen und fruchtbaren Planungsprozess in Gang: Der Anspruch des Erhaltes möglichst vieler Bausubstanz, der Anspruch auf Minergiestandard, der Anspruch auf Sicherheit , der Anspruch auf grosszügige Räume, der Anspruch auf ökologische Baumaterialien und Baumethoden, der Anspruch auf spätere Umnutzungen, der Anspruch auf Anpassungen und der Hauptanspruch, dem Erhalt der speziellen und herrlichen Stimmung die vom bestehenden Haus ausgeht.
Die Stärken und die Schwächen
Neben dem zügeln und aufeinander Abstimmen der teilweise kontroversen Ansprüche, stellt sich für den Architekten die Hauptaufgabe im Aufspüren der Stärken und der Schwachstellen des Vorhandenen. Es galt zu vermeiden, mit gut gemeinten Eingriffen den Ort zu schwächen, ihm Kraft zu nehmen.
Der Bezug zur Umgebung
Anfangs Jahrhundert war es noch selten, dass Wohngrundrisse einen intensiven Bezug zum Garten, zu den Aussenflächen verlangten. Hier führten Treppen zum Hauseingang, zum Küchen- und Kellereingang.
Die Balkone lagen vor dem Schlafzimmer und Badezimmer im 1. OG. Das Esszimmer, der Wohnraum war vom Garten abgeschnitten. Die Räume sind eng, entsprechen nicht der Grosszügigkeit und Erhabenheit welche die Fassaden ausdrücken.
Auf zwei Ebenen verknüpfen wir nun das Gebäude mit dem Gelände: die partielle Freilegung des Kellergeschosses im Westen erlaubt das Einrichten von Wohnzimmern im ehemaligen Keller und die Option einer Einliegerwohnung; heute wird das Sockelgeschoss von einer Spielgruppe des Quartiers bevölkert.
Das kleinräumige Erdgeschoss erfährt eine Erweiterung mit dem 45 m2 grossen verglasten Wohnraum. Mit zwei Stufen und einer Anschüttung kann die Höhendifferenz überlistet werden.
In Zeiten von intensiver Kälte, kann der Raum abgekoppelt werden. Die sorgfältig gearbeitete Holzakustikdecke (Topakustik- Elemente) kompensiert die Nachteile der grossflächigen Verglasung.
Der Küchenzugang bleibt, erschlossen mit einer Rampe für den Einkaufswagen statt der üblichen Treppe.
Das Erdgeschoss profitiert von der spannenden und naturnahen Umgebungsgestaltung. Der Blick in die Ferne ist von der heterogenen Bausubstanz der Nachbarschaft versperrt.
Anders im Dachgeschoss: Da öffnet sich der Blick auf die Dächer der Altstadt, die Türme der
Stadtbefestigung und der Kirchen, den See, die Hügelzüge, die Berge und die Alpen. Diesen Blick galt es zu erweitern, ihn aus der Tiefe des Raumes erleben zu lassen. Die bis zum Boden vergrösserten Fenster, der kleine Balkon sowie der offenen Grundriss erfüllen diesen Wunsch.
Die interne Erschliessung
Es waren die unterschiedlich laufenden Treppen, die Zwischentüren, die Lichtverhältnisse, welche wesentlich zur eher beklemmenden Stimmung und zur Unübersichtlichkeit im Gebäudeinnern führten. Im bestehenden, strassenseitigen Annex verbindet die neue, transparente Treppenanlage aus Stahl mit Holzstufen die vier Geschosse. Die Abschlusstüren mit Glaseinsätzen garantieren, dass das Licht seinen Weg immer finden kann. Die Grosszügigkeit ist eingezogen.
Die Energie
Von den energetischen Massnahmen sind einzig die Kollektoren auf dem neuen Anbau sichtbar. Sie sollten gesehen werden, desshalb die etwas provozierende Schräg-Aufstellung. Anstelle der diskreteren Möglichkeit der liegenden Vakuumkollektoren.
Das nicht von den Kollektoren erwärmte Wasser, sowie die Wärme für die zum Teil vorhandenen und zum Teil neu installierten Radiatoren mit offener Leitungsführung wird mit einer Gaswandtherme erzeugt. Die Rohre der Ersatzluftanlage konnten in den heruntergehängten Gangdecken verstaut werden, das Wärmetauscheraggregat in einem Kellerraum.
Eine tüchtige Wärmedämmung erfuhr der Anbau, die Dachlandschaft, die Terrassen-untersichten, die Küche, das Kellergeschoss sowie alle Bauteile, welche wir bearbeitet haben. An vereinzelten Orten setzten wir die Vakuum Paneelen ein, dort wo die Zugänglichkeit ohne grossen Aufwand gewährleistet ist.
Die Fenster sind nebst Edelstahl- Distanzhaltern mit Gläsern u-Wert 0.5 ausgerüstet. Die wohl starke Dämmung führt an die Grenze der Behaglichkeit, was den G-Wert, den Ausblick betrifft.
Das Bild durch diese Gläser ist leicht getrübt. Hier ist die Harmonie zwischen den verschiedenen Ansprüchen gestört.
Dies alles führt dazu, dass der erste Umbau im Kanton Zug nach dem Minergiestandard realisiert wurde.
Neues Leben
Das Werk des Architekten .Emil Weber von 1917 konnten wir weiterführen, teilweise korrigieren. Die Ausgestaltung des Treppenhauses und des Dachgeschosses unterstützen die Ansätze des Erbauers und die Lösungen würden bestimmt auch ihn erfreuen. Die weiteren Eingriffe und die Erweiterung würden ihn eher überraschen, doch die Zeiten, die Ansprüche und die Erfordernisse ändern sich. Das Haus wird sich vielleicht nochmals wundern, was unsere Nachkommen dannzumal aus ihm machen werden.
Vorerst lassen wir ihm seine Ruhe, sofern es dazu kommt, die sechs -köpfige Familie und die vielen Nachbarskinder halten es ganz schön auf Trab.