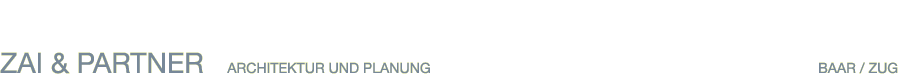Der Silobau 1929
Entwurf und Projektierung entstammen dem Ingenieurbüro A.Wickart & Cie, Zürich, die Ausführung lag in den Händen der Baufirma Heinrich Peikert, Zug, die maschinellen Einrichtungen stammen aus der Maschinenfabrik O.Meyer & Cie, Solothurn.
Die Silos
Das in der Mühle vorgereinigte Getreide gelangt durch Bandtransport zum Elevator; es wird darauf durch ein Becherwerk auf den Verteilboden über den Silokammern gehoben und hier durch ein Drehrohrsystem auf die verschiedenen Zellen verteilt; das Erdgeschoss findet als Garage Verwendung. Auf einer durchgehenden Fundamentplatte tragen vier Innen- und zwölf Aussensäulen die 27,5 m hohen Silozellen. Die Wände sind als Tragkonstruktion ausgebildet, in einer Stärke von 14 cm innen und 20 cm aussen, zwecks besserer Isolation.
Die Bauausführung fiel in die Monate August und September 1929. Mit Hilfe von Giessmast und Rinnen gelangte das fertige Betongemisch (normaler Holderbankzement 300 kg auf 1050 l Kies-Sand), im Mittel 40 bis 50 m3 pro Tag, auf den Arbeitsboden und wurde dort mittels zweier Rollkasten auf die Verwendungstelle befördert. Im Mitttel der nur 17 Tage betragenden Erstellungszeit wurde ein täglicher Fortschritt von 1,8 m erzielt; die Höchstleistungbetrug 2,7 m in 24 Stunden. Die Wände bleiben unverputzt und erhalten noch einen passenden Anstrich. Pro m3 umbauten Raumes stellen sich die Kosten auf Fr.29.50.
Die Eisenbeton-Gleitbauweise
Diese beeindruckende Leistung wird ermöglicht durch das in der Schweiz zum ersten mal angewendete Verfahren der Eisenbeton-Gleitbauweise. Entwickelt wird das Verfahren 1914 von der Macdonald Engeneering Co. in Amerika, vertreten auf unserem Kontinent durch die Eisenbeton-Gleitbaugesellschaft Heinrich Klotz & Cie in Frankfurt a.Main bzw. die Eisenbeton-Gleitbau A.G. in Basel.
Die Vorteile der Gleitbauweise bei einem Silo als Monolithbau sind die Erzielung einer einheitlichen Festigkeit ohne Betonierungsfugen dank dem kontinuierlichen Arbeitsprozess und dem auf ein Mindestmass eingeschränkten Verbrauch von Schalungsmaterial.
Die Gleitschalung besteht aus den folgenden Teilen: gehobelte und durch Nut und Feder dichtgeschlossene Schalungstafeln werden in einer Höhe von ca 1.20 m erstellt und vor der Verwendung geölt. Diese exakt gearbeiteten Schalungen sind auf horizontalen Versteifungsträgern befestigt. Durch Klammern werden die Schalungstafeln starr gefasst und damit sind auch äussere und innere Schalung auf die richtige Wandstärke distanziert.
Der Zwischenraum ist ganz leicht konisch; damit wird erreicht, dass die Haftung am abgebundenen Mauerteil möglichst klein wird, oder sich ganz vermeiden lässt. Auf den Klammern sitzt die Hubvorrichtung, die aus Zange und Spannriegeln besteht und durch die ein Rundeisen hindurchgeht, auf das sich das Ganze stützt und das man in die herzustellende Wand miteinbetoniert.Mittels Piezometerrohren, die untereinander durch Schläuche verbunden sind, kann die genaue Horizontallage der ganzen Schalung kontrolliert und eingestellt werden.
In ununterbrochenem Tag- und Nachtbetrieb wird nun diese Hubeinrichtung so bedient, dass die Schalung pro Stunde gegen 10 cm hochklettert. Dabei beschränkt man sich darauf, gleichzeitig nur einen Zehntel der vorhandenen Stützpunkte zu heben; die leichte Verdrehung, die daraus entsteht, nimmt man als unschädlich in Kauf. Vom einzelnen Hub von 3 bis 6mm geht jedesmal rund ein Viertel durch Zurücksacken wieder verloren; der Beton wird dadurch etwas eingerüttelt.Wegen des erwähnten leichten Anzugs beginnt das Ausschalen unmittelbar nach dem Abbinden der Betonmasse, das heisst nachdem sie die Plastizität verloren hat. Nach 10 bis 15 Stunden wird die fertige Wand am unteren Rand der Schalung zu weiteren Nachbehandlung sichtbar. Der Zementmörtel, der zwischen den Brettern und der Wand entweicht, läuft der eben fertigen Fläche nach und schliesst, glattgestrichen, alle Unebenheiten.Nacharbeiten lassen sich von einem Gerüst aus besorgen, das mit der Schalung hochgezogen wird.
Während die Schalung langsam hochgleitet, ist dauernd eine Arbeitergruppe mit der Verlegung der Armierung beschäftigt. Die Leute bewegen sich gefahrlos auf einem Boden, der zwischen den Schalungen montiert ist. Bei dieser mehr oder weniger forcierten Arbeitsweise sind genaue und laufende Kontrollen der Ausführung sowie der Baustoffqualitäten erforderlich. Man muss verhüten, dass die Stimmen Recht erhalten, die in allen solchen Fortschritten nur ein Zeichen der ungesunden Hast unserer Zeit erblicken.
Quelle: C.J. in der Schweizerischen Bauzeitung vom 15.Februar 1930
redigiert von: Ruedi Zai, dipl.Arch.ETH SIA September 1999